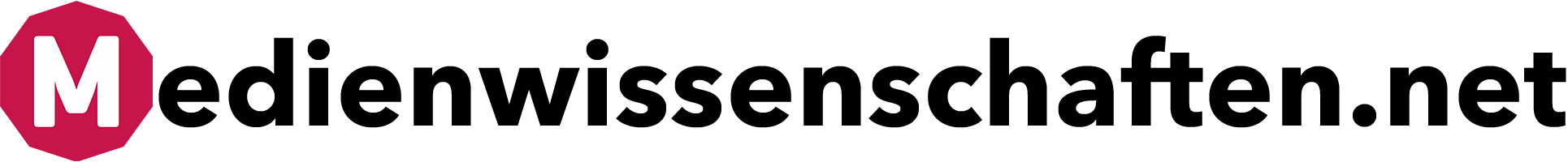Katharina Görgen und Peter Scheinpflug teilen sich seit geraumer Zeit ein gemeinsames Büro und lieben Filme über alles – nur nicht dieselben Filme. Dafür streiten sie sehr gerne. Und daher schreiben sie Kritiken zu denselben Filmen. Viel Spaß beim Lesen!
Seit FIGHT CLUB (USA/D 1999; R: David Fincher) hat wohl kein Film mehr ein so nihilistisches und alarmierendes Kaleidoskop einer umfassenden Verdrossenheit und Verzweiflung von Männerfiguren uns vor Augen geführt:
Es beginnt schon damit, dass man vergeblich nach Helden oder auch nur positiv gezeichneten Identifikationsfiguren sucht: Die Oberschicht besteht aus machtbesessenen, amoralischen Egomanen. Der Architekt und Besitzer des Hochhauses (Jeremy Irons) ist ein ebenso arroganter wie realitätsfremder Einsiedler. Der Protagonist (Tom Hiddleston) ist ein schleimiger Opportunist, der vor jeder Verantwortung flieht: für den Suizid eines jungen Mannes, seiner unverarbeiteten Vergangenheit und den eskalierenden Spannungen im Hochhaus. Ihr Glück finden alle erst in Regress und Resignation.
Denn nicht nur scheinen politische Utopien ausgedient zu haben, es sind auch nirgends Gestaltungswille oder zukunftsweisende Antworten auf brennende Fragen zu finden. Als Antwort auf das Scheitern des Ideals der friedlichen Pluralität im Hochhaus weiß der Architekt beispielsweise leider keine andere Antwort als einen nicht minder naiven Umkehrschluss: Weniger (Pluralität) sei mehr (Ordnung). Überhaupt werden alle Probleme von ihm mit derselben hohlen Phrase beantwortet: „The building is still settling.“ Er verzweifelt an seinen ebenso nobel wie unglaubwürdig klingenden Idealen und Phantasien, da er die Auseinandersetzung mit den von ihm verursachten Problemen, seine Verantwortung dafür ebenso wie das Eingeständnis, womöglich versagt zu haben, kaum mehr verdrängen kann.
Die Unterschicht hat leider auch keine Antworten parat: Wilder (Luke Evans) taugt nicht zum Vorkämpfer der Unterdrückten. Seine Rebellion ebenso wie sein aufklärerischer Anspruch, mit der Kamera die Missstände aufzudecken und die Verantwortlichen zur Rede zu stellen, sind zugleich lächerlich und traurig. Denn sie dienen ihm vor allem als ebenso geschmackloser wie befremdlicher Vorwand, um seiner Aggression und Wollust zu frönen. Dabei zeichnet sich dank dem fulminanten Schauspiel von Luke Evans seine Verzweiflung deutlich zwischen seinen strubbligen Koteletten ab. Selbstbetrug und Missbrauch befeuern sich bestens gegenseitig.
Unabhängig von ihrer sozialen Klasse haben alle diese Männer einen Sixpack. Das Training, die Körperoptimierung ist an die Stelle der Selbstverwirklichung getreten ist und steht ganz im Dienste der Transformation des Individuums in eine unermüdliche Leistungs- und Partymaschine. Stand diese Körperpolitik bei Kritikern der Moderne wie Shinya Tsukamoto noch für die zunehmende Entfremdung des Menschen von seinem Körper, seinem Gefühlsleben und vor allem anderen Menschen, so ist sie in HIGH-RISE längst zum vor allem von Männern begehrten Körperideal geworden, das als gesund, sozial erwünscht und schick gilt. Der duschende Tom Hiddleston ist kein erotisches Spektakel, er ist männlicher Narzissmus, der in seiner Erbärmlichkeit kaum zu übertreffen ist.
Wie bereits bei THE NICE GUYS störte mich auch bei HIGH-RISE ungemein, dass wieder eine Gesellschaftskritik in die Vergangenheit projiziert wurde, wodurch diverse Chancen auf eine Auseinandersetzung mit aktuellen Phänomenen (etwa der Digitalkultur) verspielt wurden. (Ja, das Buch mag aus der im Film portraitierten Zeit stammen, eine Adaption ist aber immer ihrer Zeit verhaftet.) Man kann dies freilich auch so verstehen, dass weder die offene und ehrliche Konfrontation mit der Gegenwart noch der Blick in die Zukunft gewagt wird. Die mehrfach reflektierte und kommentierte Anekdote wird zur Behauptungsstrategie im Angesicht von gefühlter Rat- und Orientierungslosigkeit. Überhaupt scheinen bestens bekannte Modelle ihre Erklärungskraft eingebüßt zu haben. Der Film bemüht sich erst gar nicht die vertikale Hierarchisierung seines Mikrokosmos ernst zu nehmen und nach Kritik- und Reflexionspotenzial zu suchen. Das Wissen über das Modell scheint schon zu genügen, um sich damit brüsten zu können. Daher brüllen die Figuren auch die Freud’schen Allgemeinplätze, die der Film in Szene setzt, unverhohlen in die Kamera. Und das war es dann auch schon damit. Die Inkohärenz des Films entspricht dem Versagen, den Sinnüberschuss zu beherrschen und einen klaren Gedanken zu fassen, der im Angesicht der Komplexität der Sachverhalte nicht banal und klischeehaft wirkt.
Wirklich widerwärtig an dem Film ist die ungeheure Misogynie: Die alleinerziehende Mutter und anfangs selbstbewusste Frau wird brutal vergewaltigt und gleicht danach einer willen-, geist- und sprachlosen Trophäe für den jeweiligen Sieger. Die gutherzige, schwangere Mutter dient allein als Brutkasten für ein Symbol der Zukunft, um dessen Besitz alle Männer kämpfen, weshalb dessen Geburtsschreie das Finale übertönen – das danach aber ebenso wenig wie sie eine Rolle spielt. Daneben gibt es ebenso snobistische wie neurotische High-Society-Diven, die nicht einmal für ihre eigenen Männer attraktiv sind, es sei denn als damsel in distress und als beinahe lebensechte Gummipuppe. Am Ende werden die Furien über Wilder herfallen, damit den letzten männlichen Aggressor tilgen, um im neuen Paradies weiße Wäsche zu waschen, die Kinder zu hüten und passiv neben dem neuen Patriarchen zu ruhen. Denn es geht unbeirrt mit dem Protagonisten und seinem Lamento weiter. Das alles ist ebenso unerträglich dämlich wie konservativ. Aber haben Männer in Krisenzeiten es nicht schon immer am leichtesten gefunden, sich durch die Abwertung und Unterdrückung des ‚anderen Geschlechts‘ zu behaupten. Am wirkmächtigsten war diese altgediente Herrschaftstaktik immer dann, wenn Frauen sie verinnerlicht haben und sie lauthals predigen – als „Gender-Gaga“ etwa –, während die Männer ihnen ungeniert in den Schritt fassen.
All das präsentiert der Film in einem biederen Retro-Chic, das wie ein lustloses Abfeiern von Hyperästhetisierung und Verfremdung daherkommt. Die Kompositionen muten zugleich ebenso merkwürdig ambitioniert wie enttäuschend klischeehaft an. Sie vermögen weder zu schockieren noch zu berauschen. Es herrscht eine allumfassende Ausdruckslosigkeit. Selbst noch der ästhetische Genuss wird dem Publikum verwehrt. Wirklich allumfassend, bei Narration, Ästhetik, Themen, Figuren etc. herrscht Regress und Resignation statt Subversion.
Und so steht am Ende von HIGH-RISE weder eine nur oberflächlich phantastisch-naiv anmutende, doch ironisch gebrochene Versöhnung der sozialen Widersacher wie einst in METROPOLIS (D 1927; R: Fritz Land) noch die allumfassende Orgie, die am Ende von SHIVERS (CDN 1975; R: David Cronenberg) ebenso zum Zwang geworden ist wie zuvor die Repression. HIGH-RISE entbehrt jeder Subversion und Innovation. Der Aufschrei bleibt in HIGH-RISE aus. Alle (überlebenden Männer) richten sich stattdessen irgendwie ein – essen Hunde und renovieren die Ruine. Das happy ending ist eine barbarische Zivilisation.
Das eigentliche Ende, der Epilog gilt jedoch dem ‚kleinen Professor‘, dem generationen- und klassenübergreifend gezeugten Kind, das alles sieht, alles weiß, mit den Konflikten aufgewachsen ist und am Ende auf dem Dach mit selbst gebastelter Technologie in seine Zukunft blickt. Übertönt und getrübt wird sein hoffnungsvoller Moment von Maggie Thatcher. Er – etwas anderes als eine männliche Zukunft scheint in diesem zwar gescheiterten, aber sich verbissen gewaltsam behauptenden Patriarchat noch immer undenkbar – wird für seine Visionen wirklich kämpfen müssen, denn die Strukturen, die er vorfindet, sind ebenso veraltet wie verfestigt.
Der Film gleicht insgesamt geradezu einem Test für unsere Zukunftstauglichkeit: Solange wir die Verwerfungen in HIGH-RISE verstehen und uns darüber ärgern, muss für uns im Gegensatz zu den Figuren im Film vielleicht noch nicht alles verloren sein.
Peter Scheinpflug