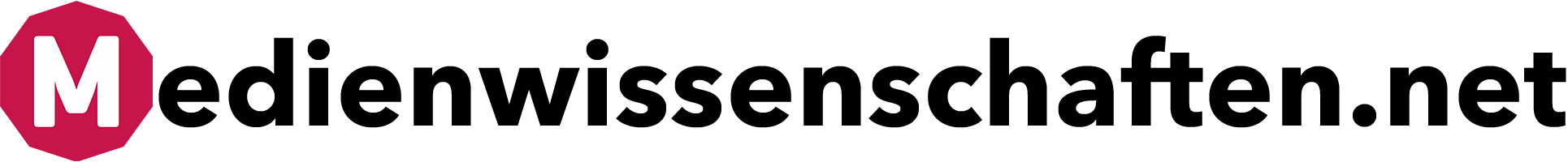Katharina Görgen und Peter Scheinpflug teilen sich seit geraumer Zeit ein gemeinsames Büro und lieben Filme über alles – nur nicht dieselben Filme. Dafür streiten sie sehr gerne. Und daher schreiben sie Kritiken zu denselben Filmen. Viel Spaß beim Lesen!
Würden wir uns mehr mögen, wenn es die Möglichkeit gäbe, an einem beliebigen Punkt einer Beziehung noch einmal neu anzufangen? Könnten wir plötzlich über alle Themen dieser Welt sprechen, stünde nicht eine vielschichtige Vergangenheit zwischen uns? Dieser spannenden Frage stellt sich der Film TONI ERDMANN, der eine Vater-Tochter Beziehung quasi seziert.
Ines und ihr Vater haben sich nur noch wenig zu sagen, auch, weil sie scheinbar in verschiedenen Universen leben. Idylle mit Garten gegen Hyperkapitalismus ohne festen Wohnsitz, wenn man so will. Besser als mit der zum Geburtstag geschenkten Käsereibe, dem unpersönlichen aber designten Geschenk lässt sich diese moderne, internationale Familienbande nicht beschreiben.
Dass wir mehr wir selbst seien können, wenn wir dies hinter einer Maske tun, ist eine alte und vieldiskutierte Theorie. In allen Kulturen tauchen sie auf, die gleichzeitig verhüllenden wie auch entlarvenden Masken. Auch Ines Vater greift immer wieder zur Maskerade und schafft so die surreale Figur des Toni Erdmann. Die schiefen, mehrfach geklebten Zähne sind seine Verteidigungsstrategie wie auch sein Angriff.
Wie würden wir reagieren, so zwingt uns der Film zu fragen, stünde unser Vater in Maskerade vor uns und unseren Kollegen? Hätten wir den Mut zu diesem Ursprung zu stehen, diesem durchaus netten Mann mit Hang zum Skurrilen? Während Ines und ihr Vater/Toni Erdmann permanent das Verhältnis zueinander neu ausloten, reihen sich für die Zuschauer/innen die Momente des Fremdschämens aneinander. Meisterlich führt uns die Regisseurin Maren Ade vor Augen, wie wenig wir es noch ertragen können, wenn soziale Codes nicht eingehalten werden. Fast körperlich ist mein Unwohlsein, als Ines ihrem Chef nackt die Türe öffnet – ob dies letztendlich ein Befreiungsschlag ist oder ein Zusammenbruch, bleibt dabei unklar und bedeutungslos. Diese sonderbare Szene, die auch vor Augen führt, wie sehr Sexualität und Alltag getrennt sind – warum sonst sollte ausgerechnet Ines Liebhaber sich weigern, unbekleidet ihre Wohnung zu betreten –, leitet die einzige echte Annäherung zwischen Vater und Tochter ein. Toni ist in einem bulgarischen Riesenkostüm gekommen, das ihn bis zur Unkenntlichkeit verhüllt und in dessen Arme sich Ines dennoch bedingungslos wirft. Ohne die Maskerade – Zottelkostüm oder Nacktheit – scheinen die beiden in ihren Welten Gefangenen nicht zueinander kommen zu können.
Dieser kurze Moment des Zueinanderfindens bleibt flüchtig und führt über diese Umarmung hinaus zu nichts. Die Lebensentwürfe bleiben unvereinbar, keiner fühlt sich bei dem andern so richtig wohl. Das mag auch daran liegen, dass die Welt der Expats als denkbar herzlos und oberflächlich gezeichnet wird.
Und so lässt uns der Film mit noch einer weiteren Frage zurück: Gibt es in der heutigen Welt wirklich keinen Mittelweg zwischen Einfamilienhaus im Nirgendwo und der internationalen Jet-Set-Karriere, die (so behauptet der Film) zwangsläufig vereinsamen lässt und echte Bindungen weder vorsieht noch zulässt?
Katharina Görgen