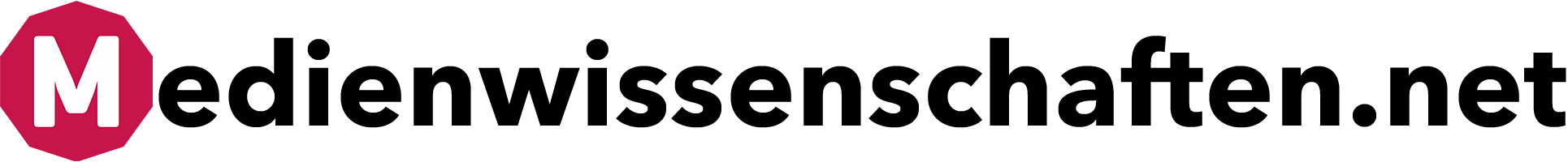Katharina Görgen und Peter Scheinpflug teilten sich für geraume Zeit ein gemeinsames Büro und lieben Filme über alles – nur nicht dieselben Filme. Dafür streiten sie sehr gerne. Und daher schreiben sie Kritiken zu denselben Filmen. Viel Spaß beim Lesen!
Katharina Görgen
Schlösse man sich dem Motto von Miss Peregrine „Unless it is necessary I don’t discuss unpleasant things“ an, bliebe für diese Kritik nur noch ganz wenig Motivation. Denn obwohl der neue Film vom einstigen Disney-Schreck Tim Burton theoretisch alle Zutaten hat, aus denen der Meister schon zauberhafte Werke über die Außenseiter, die Seltsamen und die Ungewöhnlichen dieser Welt erzählt hat, will aus der Mischung diesmal einfach nichts Charmantes werden. Und das trotz der von Peter Scheinpflug zu Recht angeführten beeindruckenden Besetzungsliste.
Gespielt von Asa Butterfield, muss Jake, die wohl dünnste Hauptfigur des Jahres, erst seinem geliebten Großvater beim Sterben zusehen und dann seine Eltern davon überzeugen, ihn in die Vergangenheit besagten Großvaters reisen zu lassen, um dessen letzten Wunsch, „go to the island“, erfüllen zu können. Auch Zuschauerinnen und Zuschauer ohne Burton- oder Fantasy-Erfahrung ist längst klar, dass auf dieser Insel all die „besonderen Kinder“ leben, von denen der Großvater einst erzählte. In einer verwunschenen Villa lebt die Truppe, behütet (oder gefangen?) von Miss Peregrine, die eine Zeitschleife von 24 Stunden vor dem Fall einer WWII-Bombe auf das Haus immer wieder abspielt, in der die Kinder von der Welt abgeschirmt sind, wobei sie dadurch auch nicht altern. Das ist wie „Täglich grüßt das Murmeltier“ in der grausamsten Phase des Lebens: der Pubertät. Und so besteht der Alltag aus kleinen Streitereien, abendlichen Kinovorstellungen aus dem Auge eines Kindes und dem täglichen Retten eines Eichhörnchenbabies. Dieser delikaten Aufgabe kommt natürlich die schöne Emma nach, da es so unglaublich praktisch ist, dass sie ja einfach am Baum hoch schweben kann, um es wieder auf den Baum zurück zu setzen. Ohne grausam wirken zu wollen: Wenn der gleiche Tag immer wieder von vorne anfängt, dann stirbt doch das Eichhörnchenbaby ohnehin immer nur für maximal einen halben Tag? Könnte man da den Nachmittag nicht ab und zu mit Sinnvollerem verbringen, als in blauem Flatterkleid durch den Garten zu schweben und jungen Männern einen Blick unter den Rock zu gönnen? Jake ist jedenfalls hin und weg von Emmas Hilfsbereitschaft und verliebt sich in die jugendliche Schönheit, der gar nichts anderes übrig bleibt, als der Dinge zu harren. Im Gegensatz zu ihm kann sie die Zeitschleife nicht verlassen – nur Jake und sein Großvater können zwischen den Welten wandeln, was einst dazu führte, dass Emma quasi in dieser Zeitschleife versetzt wurde. Gut für Junior, der kann jetzt die Liebesgeschichte des Großvaters zwei Generationen später fortsetzen, was skurril gruselig auf eine ganz eigene Art ist. Auch dass der böse Feind dann doch besiegt werden kann, liegt ausschließlich an unserem jungen Helden Jake, da weder Miss Peregrine noch ihre Schützlinge in all den Jahren je auf die Idee gekommen sind, sich eine Verteidigungsstrategie, geschweige denn einen Angriff zu überlegen. Wenn schon die Inklusion nicht geklappt hat, so hätte man doch wenigstens über Emanzipation nachdenken können. Hat man aber nicht, was mich zu der Annahme verleitet, dass ein Leben in permanenter Angst vor Wesen, die einem die Augäpfel aus dem Kopf essen wollen, dann so schlimm gar nicht ist.
Der Anführer der Augen futternden Monster, Barron, ist nicht der erste, der sich irrt, wenn er kurz vor seinem Untergang denkbar theatralisch „I am a higher being“ proklamiert. Kurz darauf erledigen ihn seine eigenen Monster, was mich meine Definition eines höheren Wesens überdenken lässt. Ich hätte sie tendenziell für schlau genug gehalten, sich eine Gefolgschaft zuzulegen, die neben gruseligem Aussehen und Augen-Hunger noch über Dinge wie Intelligenz, Witz und Einfallsreichtum verfügen – aber ich kann mich natürlich auch irren. Höheres Wesen oder nicht, mit ihm aus dem Weg geräumt, kann nichts mehr das Teenage-Happy-End auf einem rostigen Schiff verhindern. Nirgendwo ein Eisberg, wenn man mal einen braucht.
Peter Scheinpflug
Tim Burton. Eva Green. Judi Dench. Terence Stamp. Samuel L. Jackson. Fantasy. Da kann doch eigentlich nichts schiefgehen! Leider doch. Und zwar alles!
Sein Großvater, gespielt von einem wie immer famosen Terence Stamp, hat Jake seit seiner Kindheit phantastische Geschichten über außergewöhnliche Kinder erzählt, die sich in Zeitschleifen verstecken vor dem finsteren Mr. Barron, gegeben von einem wie so oft etwas arg schrillen Samuel L. Jackson. Nach dem mysteriösen Tod seines Großvaters tritt der verstörte Teenager in dessen Fußstapfen und findet – oh, Wunder! – tatsächlich das Titel gebende Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children.
Anfangs ist der Film noch durchaus vielversprechend und wartet mit großartiger Gruselstimmung und einigen wenigen Schockmomenten auf. Wer jedoch ein Highlight wie SLEEPY HOLLOW erwartet, wird bitter enttäuscht werden. Denn alsbald wandelt sich der Film zu einer arg farb- und ideenlosen Coming-of-age-Fantasy-Geschichte, die viel zu vorhersehbar ist und deren Kitsch die Logiklöcher nicht verdecken kann. Auch vom typischen Burton-Stil ist weit und breit wenig zu finden. Dafür ist alles zu konform und glatt. Es fehlen die für Burton typischen skurrilen Figuren, die immer auch hochgradig ambivalent waren, die bombastischen und bis ins Detail verspielten Bildkompositionen. Vor allem aber mangelt es dem Film an Ironie. Die Handlung ist so absehbar und die Figuren sind so unterkomplex, dass man wenig Anteil an ihrem Schicksal nimmt. Erhebt sich die Stimmung doch einmal über das Niveau eines 08/15-Fantasy-Teenie-Blockbusters, wird es schnell ekelig und arg düster. Wenn Augen penetriert, herausgerissen und verspeist werden, ist dies aber wirklich kein Augenschmaus und auch kein Augenfest.
Der Film ist so trostlos dröge, dass der Verstand unweigerlich auf Abwege gerät. In unserem Fall wurden wir zu herrlich pubertärem Spaß mit der Darstellung von Emma verleitet. Wie Katharina Görgen schreibt, handelt es sich bei Emma um den ‚blonden Engel‘ des Kinderheims mit langem, wallendem Haar, zierlicher Figur und vor Reinheit strahlenden Kleidern. Sie ist leider nie darüber hinweggekommen, dass Jakes Großvater die Zeitschleife und damit sie verlassen hat. Zugegeben, die Trauerarbeit mag in einer Zeitschleife des immer selben Tages, an dem einem ausgerechnet in der Pubertät das Herz gebrochen worden ist, gewiss etwas schwerer sein. Aber glücklicherweise verliebt sich dann ja Jake in das Mädchen, das ständig droht, davon zu schweben, da sie eigentlich Luft ist – oder zumindest war sie es 1943 für Jakes Großvater. Und so trieben wir es tolldreist weiter: Emma ist – Achtung: Geschmacklosigkeiten – mithin ein leichtes Mädchen. Von den Männern will sie zu ihrem eigenen Wohl an die Leine gelegt werden. Dafür kann man mit ihr Höhenflüge erleben, denn ihre besondere Fähigkeit ist, dass sie mächtig blasen kann. Wenn das keusche und bitterlich verletzte Mädchen sich dann auch noch waghalsig nur in weißer Unterwäsche auf Tauchgang zu einem versunkenen Schiff begibt, so dass sich ihre Körperformen umso deutlicher abzeichnen, während das Wasser an ihr hinab perlt, dann handelt es sich fraglos um einen feuchten Teenie-Traum. Diese Bildpolitik des Films wird dadurch noch creepier, dass Emma in ihrem geheimsten Versteck, das – Achtung: kulturhistorisch tradierter Gender-Topos – ein Schiff ist, Jake ausgerechnet ihr geheimes ‚Schatzkästchen‘ zeigt, in dem – Achtung! – sich das Vermächtnis von Jakes Großvater befindet. Man muss kein Kenner von Freud sein, um es merkwürdig zu finden, dass der Großvater Jake mit seinen Anekdoten geprägt hat, nur damit dieser später seinen Platz an der Seite von Emma einnimmt, um die Liebesbeziehung von 1943 fortzuführen. Das ist herrlich durchtrieben, aber macht den Film keinen Deut besser.
Nicht weniger bedenklich ist, dass der Film zwar einerseits ausbuchstabiert, inwiefern sich das phantastische Szenario als Verhandlungsfolie für das Holocaust-Trauma des Großvaters verstehen lässt, der vor den Nazis aus Polen fliehen musste und seitdem solche Monster sieht, die alle speziellen, alle andersartigen Menschen vernichten wollen. Zugleich jedoch stellen andererseits die Bombardierungsszene und die späteren Kampfszenen die ästhetischen und dramaturgischen Höhepunkte dar. Der Film bietet damit genau die Hyperästhetisierung von Zerstörung und Tod, die Walter Benjamin im Epilog seines Kunstwerkaufsatzes als Bildpolitik des Nationalsozialismus beschrieben hat.
Freilich geht es 2016 dann doch nicht mehr um den Holocaust, sondern die größte Gefahr ist ein Schwarzer, der nach Macht strebt und – Achtung! – in der Dunkelheit nur dank seiner weiß glühenden Augen zu sehen ist. Das spricht sicherlich vielen Trump-Wählern aus ihrem armen, kleinen, kalten, verängstigten Herzen. Nicht nur mit Blick auf aktuelle Debatten in den USA zur Polizeigewalt gegenüber Schwarzen und Bewegungen wie Black Lives Matter, sondern auch mit Blick darauf, dass derselbe Schauspieler, Samuel L. Jackson, erst vor kurzem im Sommerblockbuster THE LEGEND OF TARZAN einen stolzen, gebildeten, für Demokratie und Menschenrechte eintretenden Afroamerikaner gespielt hat, erscheint seine Figur in Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children umso bedenklicher und geschmackloser.
Und da selbst die ansonsten immer bezaubernde Eva Green bei Tim Burton dieses Mal nicht mehr als eine unterkühlte und distanzierte Übermutter mit Kontrollzwang sein darf, die ihre Kinder unmündig hält, damit sie weiterhin über ihr Leben herrschen kann und ihre Daseinsberechtigung nicht verliert, kann das Fazit nur lauten, dass diesem Film wirklich absolut nichts Gutes abzugewinnen ist. Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children ist einfach nur gähnend langweilig, bitter enttäuschend und in seiner Politik überaus ärgerlich.