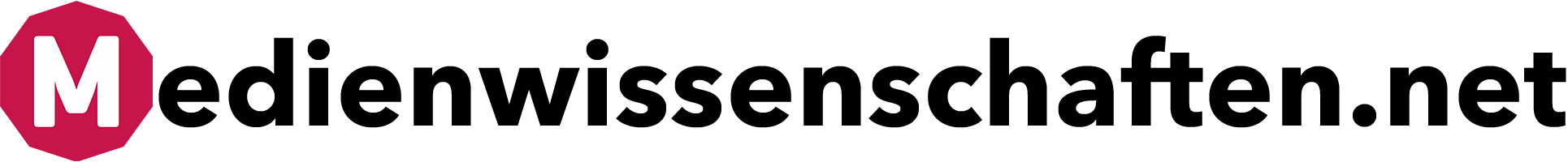Katharina Görgen und Peter Scheinpflug teilen sich seit geraumer Zeit ein gemeinsames Büro und lieben Filme über alles – nur nicht dieselben Filme. Dafür streiten sie sehr gerne. Und daher schreiben sie Kritiken zu denselben Filmen. Viel Spaß beim Lesen!
Ich muss gestehen, dass ich naturalistisch gehaltenen Animes nie viel abgewinnen konnte. Dies liegt nicht am Naturalismus – obgleich ich ihn dezidiert als manipulatives Spiel mit dem Publikum in Skandalfilmen wie Louis Malles Pretty Baby oder Richard Fleischers unterschätztem Mandingo bevorzuge. Nein, meine Vorbehalte sind durch die künstlerischen Besonderheiten des Animes begründet: Für die Animation – ähnliches gilt auch für den Comic – liegen die Grenzen des Möglichen allein in der Kreativität der Künstler. Leider erreichen uns nur wenige experimentierfreudige, avantgardistische Animes wie Dead Leaves (J 2004), Mind Game (J 2004) oder auch Space Dandy (J 2014) und noch weniger schaffen es auf deutsche Kinoleinwände. Daher bevorzugte ich bei Animes eher fantastische Sujets wie etwa Mecha oder Cyberpunk, die sich eher dazu anbieten, die Grenzen des ästhetisch Möglichen auszuloten. Seit Jin Roh (J 1999) und Perfect Blue (J 1997) erforderte es kein Anime so sehr wie Miss Hokusai (J 2015), dass ich meine Meinung gründlich überdenken muss: Zwar ist der Film weitgehend naturalistisch gehalten und zeigt einmal mehr überaus eindrücklich, dass der Anime mehr sein kann als nur intelligente Familienunterhaltung à la Studio Ghibli oder Genre-Feinkost à la Ghost in the Shell (J 1995). Der Film Miss Hokusai schildert in episodischer Erzählweise und in ruhiger, ja, bedachter Art das Leben und Schaffen einer Künstlerin, ihres berühmten Vaters und Meisters, ihrer blinden Schwester und manch skurriler Nebenfigur. Wie die Zeichnungen auf den essentiellen Ausdruck reduziert sind, so besticht der Film durch seine immense Feinheit, mit der er seine Figuren zeichnet. Darüber hinaus ist der Film jedoch auch nicht mehr und nicht weniger als eine Meditation über das Bild. Die einzelnen Episoden erfüllen kaum einen dramaturgischen Zweck, sondern stellen vielmehr einzelne Meditationsübungen über die Medialität des Bildes, die Bildproduktion, die Wirkung von Bildern oder auch die kulturellen Phantasmen über Bilder und das Künstlertum dar.
So lernen wir beispielsweise, dass große Künstler mehr sehen müssen als nur das Sichtbare, wenn sie wirksame Bilder schaffen wollen. Überhaupt praktizieren und predigen die Figuren alle größeren kulturellen Phantasmen über das Künstlertum: Der Künstler ist weltvergessen aber neugierig, naiv unschuldig, aber eine gequälte Seele, ganz auf seine Kunst fixiert, die ihm aber auch in seiner Obsession zur Verdrängung – etwa von Schuldbewusstein und Sexualität – dient. Große Narrative über das Genie werden so auf amüsant spielerische Weise entfaltet, wenn etwa ein Drache sich in unserer Welt zeigen muss, damit eine Künstlerin ein gutes Bild eines Drachen malen kann. Ob das imposante Drachenbild am Ende tatsächlich durch die Offenbarung eines Drachen gegenüber der Künstlerin oder aber das Ergebnis der eingehenden Studien, Skizzen und Einfühlung der Künstlerin in das, was man breit als das ‚Wesen‘ des Drachen, als die hegemonialen kulturellen Vorstellungen über Drachen bezeichnen könnte, lässt der Film freilich offen, um die Kippfigur von Genie und fleißigem Studium zu illustrieren.
Vor allem durch die blinde Schwester der Protagonistin wird dem Publikum auch vor Augen geführt, wie durch Bildkomposition und Farbgebung taktile Eindrücke evoziert werden können und wie zugleich durch Sprache Bildwelten entworfen und erlebt werden können. Der Film ruft hier die Opposition von Taktilität und Visualität, von Nähe und Ferne, von Teilhabe und Beobachtung auf, die in ach so vielen Kulturen nach wie vor unsere Vorstellungen über die Sinne bestimmt, und unterläuft sie zugleich, indem er in wiederum meisterhaft minimalistischen, auf den reinen Ausdruck konzentrierten Inszenierungen uns synästhetische Erfahrungen miterleben lässt. Zusammen mit der blinden Schwester lernen wir als Publikum aber auch, dass Bilder mehr als nur Erfahrung sind – wir lernen, die wir gerade aufgrund des Naturalismus des Films womöglich ähnlich blind wie das Mädchen sind für das, was mehr ist als allein das, was wir sehen, die Symbolik und das Lesen von Bildern.
Mit diesem Wissen sind wir gewappnet, wenn in einer anderen Episode eine reiche ‚Dame‘ aufgrund einer Höllendarstellung von Alpträumen geplagt wird – und mancher Cineast mag hier unweigerlich an Shirô Toyodas Meistwerk Portrait of Hell (J 1969) denken. Durch ihr Schicksal lernen wir nicht nur etwas darüber, wie wirkmächtig, ja, gefährlich Kunst sein kann, gerade für solche, die sich aufgrund ihrer gesellschaftlichen Position besonders sicher fühlen mögen. Darüber hinaus wird uns auch die kunstphilosophische Position vor Augen geführt, dass eine vollendete Komposition immer auch eines Kontrapunkts bedarf – hier: ein Symbol der Hoffnung und Erlösung neben den grausigen Illustrationen des ewigen Leidens in der Hölle.
Gerade in solchen Episoden wird denn auch deutlich, dass der Film seine Meditationen über Bilder und Kunst nicht vollends naturalistisch schildert, sondern wiederholt in das Register des Phantastischen wechselt, um kulturelle Phantasmen über Kunst und Künstler zu realisieren. Und gerade in diesen Momenten zeigt sich eben auch, was mich am Anime so begeistert: Wenn etwa ein ruhiger Fluss dank Animation fließend in ein Wellengetöse übergeht, um der Phantasie der blinden Schwester, der die Protagonistin gerade dasselbe Bild mit Worten gemalt hat, Ausdruck zu verleihen, so zeigt sich, dass der Anime wundersame Welten kreieren kann, die wir ohne Brechung eines Realismus-Paradigmas erleben und genießen können. Und selbst diese Phantastik, diesen Realismus der Figurenpsyche stellt der Film noch in den Dienste seiner Kunst-Verhandlungen, wird der/die Künstler/in doch wieder einmal als Grenzgänger/in zwischen den Welten gezeigt.
All dies spielt der Film mit solcher Leichtigkeit, mit solcher Balance aus besinnlichen und heiteren Momenten durch, vor allem aber mit solchem Spaß am Thema und am Medium durch, dass das interessierte Publikum sich ganz wir der Hund fühlen mag, der anfangs noch die Künstler und ihr Schaffen ebenso aufmerksam wie unbeteiligt beobachtet, bevor er gegen Ende hin schließlich aus Herzenslust mit den Papierknäueln voller unvollendeter Skizzen und Entwürfe in der Galerie spielt.
Ohne Frage mag dies mancher/m im Publikum dennoch arg beschwerlich vorkommen. Zumal der Film keiner konventionellen Dramaturgie folgt, sondern eben Meditationen aufeinanderfolgen lässt, in die man sich ebenso versenken muss, wie man sich in ein Kunstwerk versenkt. Wenn der Film gegen Ende dann doch ein größeres Stück konventioneller Narration aufbietet, um zugleich sowohl von enttäuschter Liebe als auch von der schweren Krankheit und dem tragischen Tod der blinden Schwester der Protagonistin zu erzählen, so steht auch dieses Stück Melodrama ganz in der Funktion der Kunst-Verhandlungen: Ausgemalt wird nämlich die kulturelle Vorstellung, dass eine Künstlerin, will sie eine wahrhaft ‚geniale‘ Künstlerin sein, etwas Bedeutendes erfahren haben muss, um ‚wahre‘ Kunst aus sich selbst heraus zu schaffen, statt Stile, Vorbilder oder die sichtbare Welt zu imitieren.
Freilich liegt auch bei diesem Film wieder manches im Argen: Das Schicksal der Protagonistin ist letztlich kaum mehr als die Leinwand, auf die das Portrait eines großen männlichen Künstlers und seine Kunstphilosophie gezeichnet werden; Männer dürfen erotische Szenen malen und dadurch Ruhm ernten, während Frauen erst in emotionalen und romantisch-naiv anmutenden Naturszenen Perfektion finden; Frauen sind überhaupt wieder beschränkt darauf, Nebenfiguren, die Mutter, Prostituierte oder eben Opfer zu sein – hier legt der Film Zeugnis ab von der Misogynie, die in der Kunst wie in der Kunstproduktion leider eine eigene viel zu lange Tradition hat.
Wenn uns am Ende schließlich noch mitgegeben wird, dass der ‚wahre‘ Künstler bis zu seinem Tode nach Perfektion strebt, und plötzlich die Vergangenheit in die Gegenwart übergeht mit einem match cut, bei dem Kubrick und Kurosawa vor Neid erblassen müssten, dann können wir nicht anders, als aus einem so an kunsthistorischen Zitaten und ästhetischen Spielereien reichen Film zu gehen mit dem tröstlichen Wissen, dass große Künstler/innen zwar sterben und oft auch in Vergessenheit geraten mögen, die Kunst aber auch heute noch fortlebt: im Anime, der die lange Tradition der bildenden Kunst fortschreibt.
Peter Scheinpflug