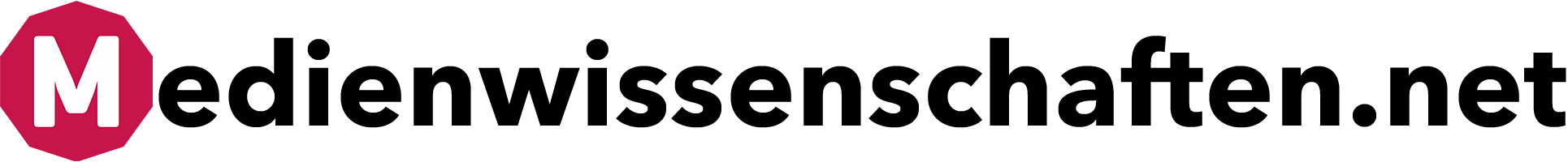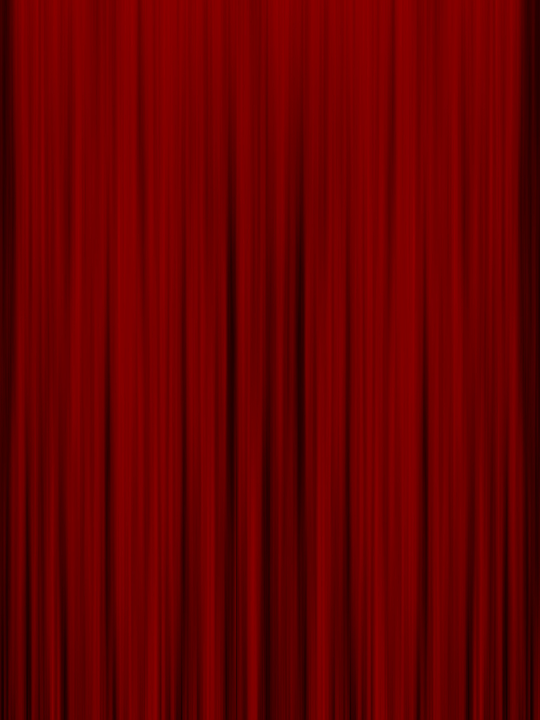Am 28. Februar ist es soweit: Die Golden Globes 2021 werden verliehen! Statt wie gewöhnlich Anfang Januar wurde die Preisverleihung aufgrund der andauernden Corona-Pandemie um fast zwei Monate nach hinten verschoben.
Die Mitglieder der Medienredaktion haben sich trotzdem ein paar nominierte Produktionen (von denen ein beträchtlicher Teil auf Netflix erschienen ist) angeschaut und teilen vorab ihre Meinungen mit.
One Night in Miami (R: Regina King)
One Night in Miami ist ein Film, den viele bestimmt nicht auf dem Schirm haben, der aber sehr wohl überzeugen kann. Im Februar 1964 gewinnt der Boxer Cassius Clay, der sich nachher zu Muhammed Ali umbenennt, den Weltmeistertitel und feiert den Sieg mit dem Aktivisten Malcolm X, dem Sänger Sam Cooke und dem NFL-Spieler Jim Brown in einem Hotelzimmer. Dort schmeißen sie aber keine fette Party. Im Gegenteil: Sie diskutieren über Rassismus, Politik, Identität und vor allem über ihre Rolle im Civil Rights Movement. Das endet nicht selten in Streitgesprächen.
Inspiriert von wahren Begebenheiten, beruht die Handlung auf dem gleichnamigen Theaterstück von Kemp Powers, der in der Film-Adaption als Drehbuchautor mitwirkt. Diese Herkunft kann der Film angefangen bei den wenigen Kulissen auch nicht verleugnen. Wegen einer ausführlichen Exposition braucht der Film außerdem seine Zeit, um in die Gänge zu kommen. Es wird oft kritisiert, dass sich die Inszenierung nicht von seinen Dialogen loslösen kann, aber das scheint auch so gewollt zu sein von der Regisseurin Regina King. Damit macht sie tiefe Einblicke in die Stärken und Schwächen der einzelnen Figuren möglich. Mit ihrem Regiedebüt beweist King, die als Schauspielerin bekannt ist, ihr Können auch hinter der Kamera. Zurecht ist sie dieses Jahr als eine von drei Frauen für die Kategorie der besten Regie nominiert.
Leslie Odom Jr., bekannt aus dem Musical Hamilton, spielt den Musiker Sam Cooke und ist für seine schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle nominiert. Er brilliert mit seiner Interpretation eines Sängers, der mit seiner Rolle im Kampf um Rechte für Schwarze hadert. Er versucht sich die Akzeptanz der weißen Bevölkerung zu „ersingen“ und will seine Stimme zunächst nicht für den größeren Zweck im Kampf gegen Rassismus nutzen. Der Cast insgesamt ist so stark, dass die Figuren allesamt zum Leben erweckt scheinen. Mit dem Song „Speak Now“ ist Leslie Odom Jr. geich nochmal nominiert für einen der begehrten Preise. Dieses Lied trägt eine wichtige Botschaft: Es ist ein Aufruf, weiterzukämpfen. Es gebe noch viel zu tun, aber der richtige Zeitpunkt sei immer jetzt. Auch wenn der Film in den 1960ern spielt, ist die Message und Thematik auf keinen Fall Geschichte, sondern immer noch aktuell und gegenwärtig. – Sara
Emily in Paris
Warum die Nominierung von Emily in Paris mehr als nur schlechter Geschmack ist
Die 78. Golden Globes stehen an und überraschen mit mehr als fragwürdigen Nominierungen. Eine davon ist Emily in Paris – eine langweilige, elitäre Serie über irgendeine Emily aus Chicago, die in eine französische Marketingagentur versetzt wird. Die auf High Heels umherstolzierende Emily wird mit einem klischeehaften und realitätsfernen Paris konfrontiert: Verführerische, doch unfreundliche Einwohner*innen in einer Stadt, in der nur glamouröse Neureiche zu leben scheinen. Emily wird von Lily Collins gespielt, die eigentlich schauspielerisches Talent hat. Dieses taucht jedoch in der Serie nicht auf. Der einzige Gesichtsausdruck, den die eindimensionale Figur zur Schau stellt, ist ein künstliches Werbelächeln. Die konservative Oberflächlichkeit von Emily in Paris wird bis zum Ende aufrechterhalten. Dennoch ist Lily Collins für „Best Actress“ und die Serie für „Best Comedy“ nominiert, was tatsächlich etwas witzig ist, da die Serie selbst wohl keinen einzigen Menschen zu Lachen gebracht hat. Sie ist auf so lächerliche Weise mit Klischees und überschaubaren Handlungssträngen geschmückt, dass die Nominierung bisher schon viele Kritiker*innen entrüstet hat. Und zwar so viele, dass die New York Times Nachforschungen angestellt hat. Das Ergebnis ist unglaublich: Nur einer kleinen Gruppe von 100 Journalist*innen ist es erlaubt, über die Gewinner der Golden Globes zu entscheiden. Von denen wurden rund 30 Mitglieder*innen nach Paris eingeladen – höchstpersönlich vom Emily in Paris Studio. Dort wurden sie „wie Könige und Königinnen“ behandelt, wie ein Teilnehmer anonym berichtet. Auf dem Tagesplan standen Besuche zum Set, Übernachtungen im Fünf-Sterne-Hotel und exklusive Mittagessen in einem Privatmuseum, das in der Serie zu sehen ist. Die New York Times kommt zu dem Schluss, es gebe „die weitverbreitete Annahme, die Mitglieder könnten durch spezielle Aufmerksamkeiten bequatscht und beeinflusst werden.“ Auch früher kamen bereits Vorwürfe bezüglich der Käuflichkeit von Golden-Globes-Kritiker*innen ans Licht. Da die meisten Studios jedoch von einer Nominierung abhängig sind, wird dies anscheinend einfach in Kauf genommen.
Ernsthaft? Haben wir nicht schon genug elitäre Preisverleihungen, die keinerlei Diversität vorweisen wollen? Da bleibt nur zu hoffen, dass Emily in Paris nicht auch noch gewinnt. Besonders da andere Serien alleine die Nominierung viel mehr verdient hätten. Beispielsweise May I Destroy You; die divers besetzte und tiefgängige Serie von Michaela Coel über Missbraucherfahrungen und sexueller Selbstbestimmung. Die visuell überragende Serie wurde jedoch mit genau null Nominierungen belohnt. Im Zuge des Black History Months ist May I Destroy You umsonst auf HBO zu sehen. – Ivana
Kategorie: Bester Animationsfilm
In der Kategorie Bester Animationsfilm sind in diesem Jahr The Croods: A New Age (DreamWorks), Onward (Disney Pixar), Over the Moon (Netflix), Soul (Disney Pixar) und Wolfwakers (Cartoon Saloon) nominiert worden. Wie jedes Jahr stellt sich mir dieselbe Frage: Wer wird gewinnen?
Alle fünf Filme haben ihre Stärken, sorgen für Lacher und regen zum Nachdenken an. Doch mein persönlicher Favorit steht längst fest: Over the Moon. Der Film hat mich mit einer Mischung aus chinesischer Mythologie, aufheiternden Musicalnummern und Antigravitationstischtennisspiele überzeugt. Es werden aber auch ernste Thematiken aufgegriffen. Es geht nämlich um ein kleines Mädchen, das ihre Mutter verloren hat, und Jahre später ist plötzlich eine neue Frau da sowie ein nerviger Stiefbruder. Und sagen wir es mal so: Sie geht nicht soooo super damit um. Sie baut eine Rakete, um zur Mondgöttin zu gelangen, denn ihre Mutter hat ihr immer die Geschichte der Göttin erzählt. Und sie möchte ihrem Vater den Beweis liefern, dass es die Göttin gibt, um so die verstorbene Mutter wieder in Erinnerung zu rufen. Dieser Plan setzt ein turbulentes, buntes Abenteuer in Gang, dessen Ende für die reinsten Glücksgefühle sorgt. Perfekt also für die Winter- und Coronatage.
Jedoch denke ich, dass schlussendlich (leider) der sehr philosophische und jazzige Film Soul das Rennen machen wird. Der Film punktet neben einem diversen Cast noch mit fundamentalen Fragen wie: „Was kommt nach dem Tod? Was ist davor? Und warum leben wir? Was ist der Sinn des Lebens?“ Und all das wurde in die vertraute heitere und stimmige Atmosphäre eines Pixarfilms verpackt.
Wer nun am Ende die desinfizierte Trophäe erhalten wird, werden wir am Ende des Monats sehen. Eins steht aber bereits fest: Animationsfilme sind das beste Mittel gegen Stimmungstiefs während der Pandemie. – Æther
Ma Rainey’s Black Bottom (R: George C. Wolfe)
Es gibt viele gute Gründe, Ma Rainey‘s Black Bottom (R: George C. Wolfe) zu gucken, allen voran die herausragende Performance von Viola Davis als „Mutter des Blues“ Gertrude ‚Ma‘ Rainey und Chadwick Boseman als ehrgeiziger, überdrehter Trompeter und Rising Star Levee Green. Es ist der letzte filmische Auftritt des im letzten Jahr verstorbenen Black Panther-Darstellers – und was für einer. Beide sind in der Kategorie der besten Hauptdarsteller*innen völlig zurecht nominiert und könnten gute Chancen haben.
Nicht nur für Blues-Fans dürfte außerdem die Musik ein absolutes Highlight des Films sein, aber auch Kostüme und Szenenbild wirken absolut stimmig. Trotzdem ist es vor allem die darstellerische Leistung von Davis und Boseman, die hier die Handlung trägt: Diese spielt an nur rund einem einzigen Tag im Tonstudio – Ma Rainey soll gemeinsam mit ihrer selbst ausgewählten „Georgia Band“ ein paar ihrer Songs aufnehmen, doch es kommt zu einer ganzen Reihe an Auseinandersetzungen und Verzögerungen. Das mag erstmal trivial erscheinen, doch geht es bei den Konflikten mal mehr, mal weniger subtil um die Ausbeutung Schwarzer Musiker*innen durch weiße Produzenten, deren Verdienst an Ma Raineys Musik ungleich höher sein dürfte. Wie tiefgreifend die diskriminierenden Strukturen, wie traumatisch die Erfahrungen mit Rassismus sind, bricht in den Dialogen immer wieder hervor.
Deren auffällige Länge ist der Tatsache geschuldet, dass es sich bei Ma Rainey’s Black Bottom um die Adaption des gleichnamigen Theaterstücks von August Wilson handelt. Trotz der virtuosen Performance ist die Dialoglastigkeit auch ein Wermutstropfen: Was im Theater dank leiblicher Kopräsenz und der entsprechenden Atmosphäre sicher gut funktioniert hätte, wirkt im Film stellenweise langatmig und irgendwie unfertig.
Unterm Strich ist Ma Rainey’s Black Bottom dank großartiger Besetzung und unheimlich relevanter Thematik definitiv sehenswert – auch wenn man sich vielleicht wünscht, das spektakuläre Spiel und die tolle Musik live als Theaterstück oder im Kino zu sehen. Nur eben nicht ausgerechnet daheim auf dem Laptop. – Katharina