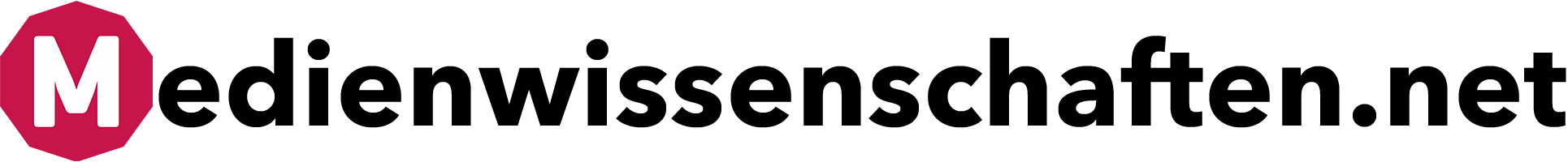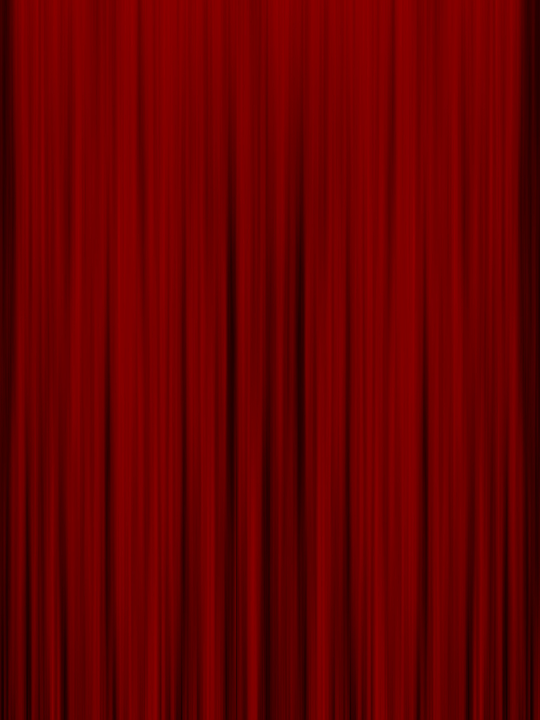Der zweite Avatar Teil ist ein bisschen wie das Vingster Seebad: Sieht schön aus, aber hat keine Tiefe.
James Cameron hat es wieder getan. Er hat streng amerikanisch-konservative Werte einer außerirdischen Welt und einer, auf den ersten Blick, vollkommen neuen Kultur aufgezwungen. Er verzichtet auf die Möglichkeit, eine alternative Gesellschaft voller Zusammenhalt, Naturverbundenheit, Magie und Gleichheit zu kreieren, und entscheidet sich lieber dafür, eine familiäre Dynamik darzustellen, an der sich eine republikanische Kernfamilie mit Freuden ein Beispiel nehmen würde. Jake Sully (Sam Worthington), der weiße Mann, der sich im ersten Avatar Teil die native Kultur der Na’vi angeeignet, den Krieg beendet, und nicht nur Teil des Volks wurde, sondern auch sein Held, wird als strenger Militärsvater dargestellt. Seine zwei Söhne nennen ihn „Sir“, es wird nicht über Gefühle geredet, sondern nur salutiert. Für die Emotionalität ist Mutter Neytiri, großartig gespielt von Zoe Saldana, zuständig, so wie es sich in einer heteronormativen Familie gehört. Dass sie bisweilen zu emotional wird und immer mal wieder von Jake in seine Schranken gewiesen werden muss, stört ihn nicht, denn so sind Frauen und Mütter halt. Sein „Babygirl“ ist emotional einfach noch nicht so ausgereift. Und es ist schließlich die Aufgabe des Vaters, seine Familie zu beschützen. Diese Weisheit ist der Kern des Films und wird auch mantraartig mehrfach wiederholt.
Es ist die Verantwortung des Vaters, dass seinem Volk und seinen Liebsten kein Leid geschieht. Als die familiäre Idylle durch die Rückkehr der Himmelsmenschen gestört wird, bringt Jake seine widerwillige Frau und seine emotional vernachlässigten Kinder kurzerhand zu einem anderen Stamm. Und zwar zum Wasserstamm Metkayina, unweit vom Waldstamm, dem Heimatsort von Neytiri. Irrelevant ist dabei die Gefahr, in die Jake damit den Wasserstamm bringt, da er durch seine Aufdringlichkeit ja sein Volk und seine Familie beschützt, so als Mann.
Die Themen des Films sind in drei Wörtern zusammenzufassen: Vaterschaft, Ungerechtigkeit und Rache. Warum 80 Prozent des Films jedoch Krieg und Mord beinhalten, lässt sich schwerer erklären. Die inneren Beweggründe der Menschen, unzählige Avatare zu foltern und abzuschlachten, werden im Film nicht klar. Aber das scheint auch nicht wichtig. Schließlich ist Krieg schwarz-weiß und es gibt immer die Guten und die Bösen. Warum Colonel Miles Quaritch (Stephen Lang) jetzt genau das Leben von zahlreichen Amerikanern aufs Spiel setzt, um einen einzigen Mann zu töten, ist eigentlich egal. Die Kampfszenen sind dafür mega gut inszeniert und spannend sind sie ja auch. Und hey, die Bilder der Meereswesen waren schön. Wenn sie grade nicht brutal ermordet wurden, versteht sich.
Leider dämpfen die blauen Gesichter der Schauspieler*innen die Emotionalität in einigen Szenen. Zoe Saldana ist die einzige, deren schauspielerisches Talent die Brücke der digital gezeichneten Aliengesichter überwinden kann. Was die alienartige Gestalt der Figuren jedoch anscheinend rechtfertigt, ist die Sexualisierung der minderjährigen Kiri, die sich gerne halbnackt im Gras räkelt, während die Kamera lasziv an ihrem Körper entlangfährt. Aber das ist ja nicht so schlimm, denn die Figur wird von einer erwachsenen Frau (Sigourney Weaver) gespielt. Nur ihr Körper ist der eines Kindes. Da kann man ruhig mal gucken.
Die einzige Figur, deren reales Gesicht nicht von CGI versteckt wird, ist Spider, gespielt von Jack Champion. Es ist ein Jammer, dass ausgerechnet Champion durch sein menschliches Gesicht und die dadurch einfache Identifikation häufiger im Fokus steht, denn er ist mit Abstand der unemotionalste Schauspieler im Film. Emotional aufgeladene Szenen werden durch sein ausdrucksloses Gesicht und seine gefühlslosen Augen durchbrochen. Selbst die hochdramatische Todesszene, die den Höhepunkt des Films darstellt, wirkt durch die Einblendung von Spiders Gesicht, das verzweifelt versucht, jegliche Emotion widerzuspiegeln, fast humoristisch. Die unbeholfene und oberflächliche Darstellung seines ambivalenten Charakters, hin und her gerissen zwischen Loyalität und Blutsfamilie, befürwortet ebenfalls keine Sympathie für die Figur. Diese flachfallende Charakterisierung ist jedoch keine Ausnahme. Die meisten Figuren lassen sich mit einem Wort zusammenfassen. Vater, Mutter, Außenseiter, Bösewicht, Hottie. Keine Unterhaltung geht in die Tiefe, aber manchmal gibt es einen Witz, der bestimmt unter einem Facebook-Post aus 2011 entdeckt wurde.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die 190 Minuten Spielzeit von Avatar angefühlt haben wie ein überlanger Einblick in die Lebensrealität einer konservativen Kernfamilie, die den Film mit dem Vorhaben verlässt, einen Screenshot einer Filmszene mindestens als Desktophintergrund festzulegen. Vielleicht wird sogar ein Puzzle gekauft.
Anmerkung der Redaktion: Wie kontrovers die Meinungen um den Film sind, seht ihr, wenn ihr Marius Rezension zu dem Film lest, denn er konnte dem Film viel mehr abgewinnen als Ivana.