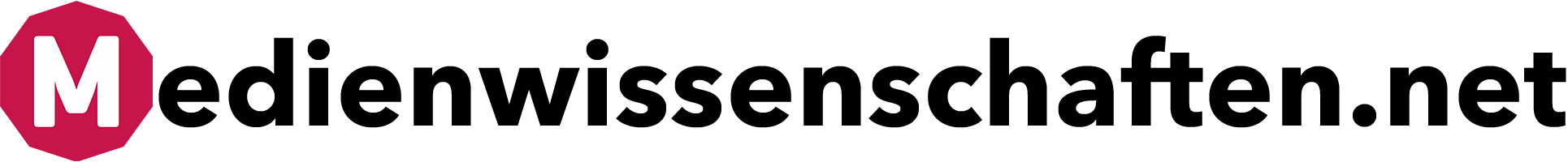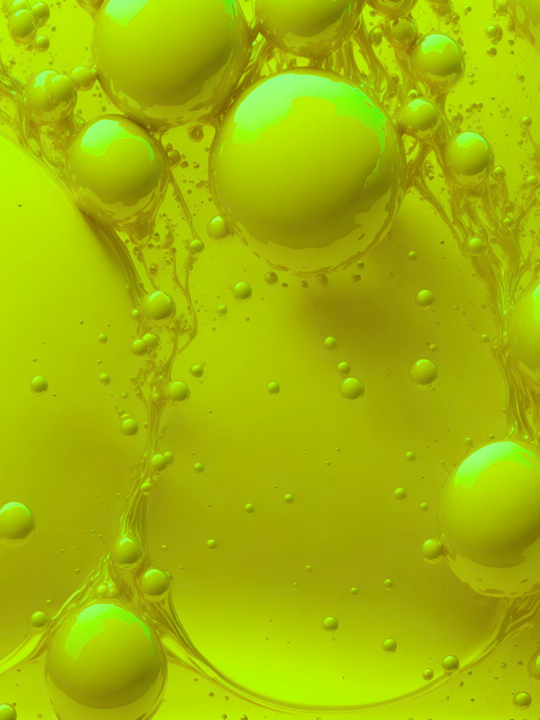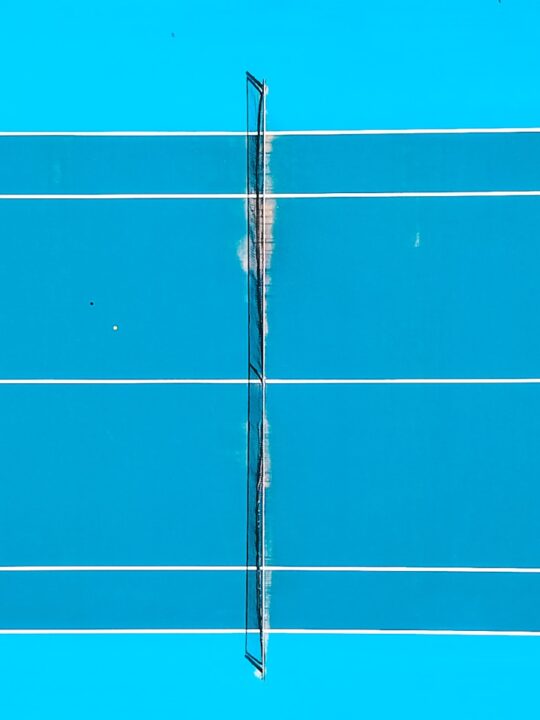Streaming-Anbieter wie Netflix, Amazon, Hulu, Sky und Co. setzen immer öfter auf Eigenproduktionen, die mal mehr und mal weniger überzeugen. Deshalb präsentieren euch die Autor*innen der Medienreaktion im Rahmen unserer Filmklassiker-Reihe die Originals, die sie in letzter Zeit besonders berührt, beeindruckt und unterhalten haben. Mit dabei sind diesmal auch einige zum Binge-Watching einladende Serien sowie ein Film: Daisy Jones & the Six (2023), Arcane (2021), Fleabag (2016-2019), Outer Banks (2020-), Ripper Street (2012-2016) und The Irishman (2019). Vielleicht sind darunter ja auch eure Favoriten, oder die ein oder andere Neuentdeckung!
Daisy Jones & the Six: Wenn Musik die Stille durchbricht
Wenn mein Vater mir einen Tipp zu Filmen, Büchern oder Serien gibt, läuft die Konversation meistens folgendermaßen ab: Papa: „Hast du schon XY gesehn?“ Ich: „Nein.“ Papa: „Was? Aber du studierst doch Medienkulturwissenschaften! Das musst du gesehen haben!“
In der Regel rolle ich dann mit meinen Augen und schaue mir den Film, das Buch oder die Serie nicht an. Bei Daisy Jones & the Six war es anders. Nach den Erzählungen meines Vaters musste ich unbedingt reinschauen – und ich wurde nicht enttäuscht.
Das Amazon-Original feierte seine Erstausstrahlung am 03. März 2023 und ist seitdem auf sämtlichen Social Media Plattformen durch die Decke gegangen. Die Serie besteht aus zehn Folgen und basiert auf der gleichnamigen literarischen Vorlage der amerikanischen Autorin Taylor Jenkins Reid, die manche vielleicht auf Grund ihres Bestsellers The Seven Husbands of Evelyn Hugo kennen. Daisy Jones & the Six erzählt die Geschichte einer Bandgründung in den 1970er Jahren und ist vollgepackt mit kleinen popkulturellen Easter Eggs, die nur darauf warten von den Rezipient*innen ausgepackt zu werden.
Neben dem wahnsinnig hochwertig produzierten Soundtrack, der in Form eines Albums der fiktiven Band bei sämtlichen Musik-Streamingdiensten zu finden ist, und seit Wochen bei mir in Dauerschleife läuft, ist der Cast fantastisch. In den Hauptrollen sind Riley Keough – übrigens die Enkelin von King of Rock ’n‘ Roll Elvis Presley – in der Rolle der Daisy Jones und Sam Claflin als Billy Dunne. Aber auch der Rest der Crew zieht einen in den Bann. Besonders gelungen ist die Ausarbeitung der Handlungen der einzelnen Nebenfiguren. Diese bekommen genauso ihre eigenen kleinen Geschichten, die genauso liebevoll detailliert sind wie eben die der Protagonist*innen. Es wird ein stimmiges und in sich geschlossenes Bild einer Band gezeichnet, die durch ihre zwischenmenschlichen Konflikte immer wieder aneinandergerät. Zwar mag der Großteil des Endes schon von Beginn an vorauszuahnen sein. Dennoch ist die letzte Folge für eine kleine Überraschung und vielleicht sogar für ein paar Tränen gut.
Im Vordergrund der Serie steht die Musik. So werden künstlerisch-ästhetische Debatten von den Bandmitglieder gehalten und Genderfragen und Rassismus in der Musikbranche der 1970er Jahre ausdiskutiert. Es zeigt sich aber auch die Macht der Musik als Ausdrucksmittel von Gefühlen und als möglicher Ersatz für Kommunikation. So wird die Musik zur Lösung von Sprachlosigkeit und Gefangenheit der einzelnen Figuren stilisiert, und das, ohne dabei kitschig zu sein.
Was zum Schluss unbedingt noch unterstrichen werden sollte, sind die Kostüme des Casts. Neben bunten Tuniken, breiten Schnauzbärten und schicken Ponyfrisuren finden sich auch die ein oder anderen Cowboyboots und Jeanswesten wieder, die einen direkt in die Zeit von Fleetwood Mac und Co. zurückversetzen – und je nach dem einen kleinen bis großen Kaufrausch auslösen können.
Die ganze Serie in sich ist stimmig und fesselt einen von Sekunde Eins. So schaffen es die Regisseur*innen Nzingha Stewart, James Ponsoldt und Will Graham durch einen klugen Wechsel zwischen Interview-Sequenzen und Rückblenden über die ganze Staffel hinweg interessant, ohne dabei gezwungen locker zu wirken, zu erzählen. Solltet ihr also Daisy Jones & the Six noch nicht gesehen haben: lasst euch drauf ein und genießt die kleine musikalische Zeitreise mit herrlich-sommerlichen 70s-L.A.-Flair! – Emma
Arcane
Die Serie Arcane (2021) ist inspiriert durch das populäre Online-Game League of Legends. Zunächst habe ich daher aufgeschoben, das Netflix-Original zu sichten, da ich nach The Witcher nicht viel von einer Spielverfilmung erwartet habe. Aber meine Vorurteile waren mehr als unberechtigt: Arcane ist in allen Aspekten der Serie ein Meisterwerk.
Die Serie behandelt das zerbrechliche Gleichgewicht zwischen zwei Städten: dem privilegierten Piltover und dem Zhaun der Unterklasse. Durch die Erfindung der magischen Technologie Hextech drohen die Spannungen zu eskalieren. Arcane diskutiert parallel auf liebevolle und kreative Art die Beziehung zwischen den zwei verwaisten Schwestern Vi und Powder, die durch einen schrecklichen Unfall jahrelang getrennt wurden. Powder wurde als Kind von niemandem wirklich ernst genommen. Als Kompensation dafür macht sie während der Trennung von ihrer Schwester eine extreme Verwandlung durch.
Die tragische Serie behandelt Themen wie Klassenkampf, Gewalt, Armut, Trauma, Diskriminierung, Freundschaft, Familie und Zusammenhalt, fühlt sich aber trotzdem neu an. Das mehrschichtige Figurendesign, die interessanten und diversen Charaktere, und die packende und emotionale Handlung werden mit so viel Liebe zum Detail und Kreativität ausgearbeitet, dass keine Figur und keine Szene überflüssig oder oberflächig erscheint. Arcane schafft etwas, das viele andere Actionserien versäumen: Die Serie kreiert Figuren, um die man sich nicht nur schert, sondern mit denen man mitfiebert, mitfühlt, mitleidet. Figuren, deren komplexes Innenleben man über den Verlauf der Serie besser kennenlernt. Figuren, dessen Charakter sich am Ende der Serie auf natürliche Weise gewandelt hat. Jede Figur ist eine hochinteressante Charakterstudie. Es gibt kein Gut und kein Böse in Arcane. Niemand ist perfekt oder schlecht – man versteht die Intention und das Leid jeder Figur.
Zudem ist Arcane ein perfektes Beispiel dafür, wie man starke weibliche Figuren schreibt. Die Diversität der weiblichen Figuren der Serie geht auch auf ihr Charakterdesign über. Viele Serien und Filme haben bestimmte Tropes, in die die meisten weiblichen Figuren reinpassen. Extreme Emotionen werden entweder verspottet oder sind Tabu. Viele „starke“ weibliche Figuren wirken daher overpowered, emotionslos, platt und daher uninteressant. Die Kehrseite dieser Charakterisierung sind hysterische und hypersensible Figuren, die genauso unsympathisch und eindimensional wirken. In Arcane haben die weiblichen Figuren jedoch eine emotionale Bandbreite, die komplex und lebensecht ist. Es ist das Zusammenspiel von Ermächtigung und Verletzlichkeit, es ist das Unperfekte, das Fehlerhafte an den Figuren, das sie so menschlich macht. Und auch die verschiedenen zwischenmenschlichen Beziehungen der Frauen – ob Mutter-Tochter, Vater-Tochter, Familie, Liebe, Freundschaft – richten den Fokus der Show überraschend oft und vielschichtig auf ihre weiblichen Figuren und ihre emotionale Realität. Aber auf eine Art, die den Fokus auf Gender allgemein entfernt und den Fokus stattdessen auf die Figuren setzt.
Darüber hinaus ist Arcane atemberaubend animiert. Die Liebe zum Detail, die Kombination von 3D Figuren und 2D-Hintergrund, das Figurendesign und die wunderschönen Einstellungen sind außergewöhnlich und magisch.
Man muss League of Legends nicht gespielt haben, um von Arcane aus den Latschen gehauen zu werden. Arcane ist so vielschichtig und komplex, so liebevoll und magisch, dass für jede Person etwas dabei ist, was sie begeistern kann. – Ivana
Fleabag: Eine herzzereißende Komödie
„Do I have a massive arsehole?”
Mit dieser Punchline startet die britische Schauspielerin und Autorin Phoebe Waller-Bridge ihre Serie Fleabag (2016-2019), die zunächst ein One-Woman-Show auf der Theaterbühne war, und nun ein Prime-Original. Der Satz charakterisiert die namenlose Hauptfigur ganz gut: Im Mittelpunkt von Fleabag steht eine sexbesessene Frau, die durch Humor, Sarkasmus, und Sex versucht, ihre Einsamkeit, ihr Schuldbewusstsein, und den Verlust ihrer besten Freundin zu vergessen. Die kluge, intelligente und zugleich gebrochene Figur versucht durch das Brechen der vierten Wand die Zuschauer*innenschaft davon zu überzeugen, dass ihr Leben ein charmantes und lustiges Chaos ist. Je länger wir Fleabag jedoch beobachten, desto klarer wird uns, dass ihr Humor nur Schein ist. Denn der Grundstein der Hauptfigur ist Einsamkeit, tiefe Trauer und Verlust.
Fleabag ist nicht autobiografisch. Phoebe Waller-Bridge identifiziert sich jedoch stark mit ihrer Figur: Fleabag wurde inspiriert durch Waller-Bridges Zwanziger und ihre Female Rage. Die Serie fängt das Gefühl des Frauseins in der heutigen Gesellschaft auf intelligente und humorvolle Weise ein. Auch Fleabag überlegt ständig, ob sie eine gute Feministin ist:
„I sometimes worry that I wouldn’t be such a feminist if I had bigger tits.“
Ihr wird ständig von außen gesagt, was sie zu tun und zu denken hat. Zum Thema Sex sagt sie:
“I’m not obsessed with sex. I just can’t stop thinking about it. The performance of it. The awkwardness of it. The drama of it. The moment you realise someone wants your body. Not so much the feeling of it.”
Wie für viele andere übernimmt der Druck, sich sexuell wertvoll und begehrenswert zu fühlen, die eigentliche Lust am Sex. Es ist wichtiger, überhaupt Sex zu haben, als ihn zu mögen. Sex ist eine Bestätigung: Ich bin liebenswert. Ich bin wertvoll. Ich existiere.
So rennt Fleabag in Staffel eins vor sich selbst und ihren Gedanken davon. Ihre Grausamkeit sich selbst gegenüber überwindet sie mit der zweiten Staffel. Sie hat sich der Zuschauer*innenschaft nun geöffnet, kann freier und verletzlicher agieren. Sie muss nicht länger fliehen und hat endlich wieder Kapazitäten, in die Zukunft zu sehen. Dennoch ist sie verloren in der unendlichen und überfordernden Menge an Möglichkeiten. So sagt sie:
“I want someone to tell me what to wear every morning. I want someone to tell me what to eat. What to like, what to hate, what to rage about. What to listen to, what band to like. What to buy tickets for. What to joke about, what to not joke about. I want someone to tell me what to believe in. Who to vote for and who to love and how to tell them. I think I just want someone to tell me how to live my life, because so far I think I’ve been getting it wrong.”
Nach einer langen Phase des Selbsthasses kann sich Fleabag endlich erlauben, glücklich zu sein. Aber sie weiß nicht, wie. Die einzige Strategie, die sie bisher dafür hat, ist Sex, Chaos, und Selbstdarstellung. In dieser Situation trifft sie einen Mann, der das Gegenteil von Fleabag in der ersten Staffel darstellt: Sie lernt einen jungen Priester kennen, genial gespielt von Andrew Scott. Einen gläubigen Mann, der sich seiner selbst und seinem Gott sicher ist. Einen Mann, der keinen Sex hat. Und einen Mann, der sie sieht, wirklich sieht, vielleicht zum ersten Mal in Fleabags Leben.
Während sich die erste Staffel von Fleabag mit Themen wie Verlust, Frausein, Sex und Einsamkeit beschäftigt, fokussiert sich die zweite Staffel auf Heilung, Freundschaft, Familie, Liebe, Glaube und Selbstliebe. Fleabag in der ersten Staffel war auf sich allein gestellt. Sie hat sich von allen um sich herum distanziert, um keinen Verlust und keinen Schmerz erfahren zu müssen. In der zweiten Staffel ist Fleabag endlich wieder bereit zu lieben, sich zu öffnen und den Schmerz zu riskieren:
“People are all we’ve got. People are all we’ve got. So grab the night by its nipples and go and flirt with someone.” – Ivana
Outer Banks
Was ist gutes Bingeformat? Mittlerweile ein Modell von dem sich alle Streamer wieder abgewandt haben, außer Netflix, welches immer noch stur daran festhält. Doch ein schnelles Schauen macht Serien ja nicht zwingend besser und mehr noch, ein darauf ausgelegtes Werk mutiert geradezu zu einem 10-Stunden-Film, in dem künstlich Cliffhanger aneinandergereiht werden, um die Zuschauer*innen zum Weiterschauen zu bewegen, jedoch nur in der ersten und letzten Folge wirklich entscheidende Sachen passieren (Stranger Things lässt grüßen). Der wöchentliche Veröffentlichungsmodus verleitet nun mal doch dazu, Serienfolgen auch für sich stehen zu lassen, denn das Bingemodell stellt sich zum Teil eher als erschöpfend heraus, anstatt eine wirkliche Alternative zu bieten. Es sei denn natürlich man heißt Outer Banks und packt die 10 Stunden mit dermaßen vielen Ereignissen voll, dass man gar nicht mehr aus der Puste kommt. Der „Weiterschauen“-Button hat so also doch seine Freude.
Outer Banks ist eine Mischung aus Abenteuer und Teen-Drama-Soap. Das Abenteuer wird durch die den Plot vorantreibende, Schatzsuche beigesteuert, das Drama schöpfen Josh Pate und Shannon Burke vor allem aus dem Konflikt zwischen den armen und den wohlhabenden Bewohner*innen der Insel, die „Pogues“ und „Kooks“ genannt werden, falls jemandem die Dichotomie nicht deutlich genug war, und der zentralen Liebesgeschichte zwischen John B und der aus wohlhabenden Verhältnissen stammenden Sarah. Dabei sind die Hinweise in der Schatzsuche zwar mitunter so kompliziert wie Kreuzworträtsel, doch dem Spaß stellt das keine Grenzen. Im Gegenteil, es ist geradezu der Charme der Serie, nie zu wissen, mit welchen aus dem Hut gezauberten Ideen die Showrunner ankommen, um die nächste Stunde zu füllen, da sie mal eben in der letzten Folge so viel passieren haben lassen, wie es manche Netflix Serien in ihrer gesamten Staffel nicht schaffen.
Keine Frage, es ist eine Serie zum Kopfausschalten und zum darüber aufregen, warum denn die eine Figur nicht endlich mal den küssen kann, den wir von Anfang an als perfektes Match auserkoren haben (oder zum darüber aufregen, wie die Autoren glauben konnten, dass dieses Paar eine gute Idee ist). Doch es ist auch eine Show zum Mitfiebern, da sie einen nicht loslässt und die Figuren mit so viel Humor geschrieben sind, dass es immer Spaß macht, ihnen selbst bei ihren allerdümmsten Entscheidungen zuzuschauen. Zu sagen es sei eine perfekte Netflix-Serie, da man mit ihr mal eben 10 Stunden am Stück „killen“ kann – entweder nach einer erschöpfenden Woche am Wochenende oder um mal wieder zu prokrastinieren – mag stark negativ konnotiert klingen (und im Vergleich zu manchen Serien ist es das auch), doch es zeigt eben auch den Spaß dieses Formates. Outer Banks ist nicht die beste Netflix Serie, doch sie ist eine der unterhaltsamsten. Es tut gut, etwas schauen zu können, was irgendwie dumm und genial zugleich ist. Eins steht aber fest: Wer auf Teen-Soap steht, wird nicht nur auf seine Kosten kommen, sondern regelrecht davon überflutet. Und das meine ich durch und durch als ein Kompliment. – Marius
The Irishman
In einer Zeit des Kampfes von Netflix um Legitimation in Hollywood waren auch die Oscarwünsche nicht weit. So sehr diese auch von reinem Prestigewunsch getrieben sein mochten, lässt sich allerdings zumindest sagen, dass es einen Zeitpunkt gab, in dem Netflix mit dieser Hoffnung großen Regisseur*innen Filme zu drehen erlaubte, die für andere Hollywood-Studios als finanziell zu riskant angesehen wurden. Ob sich das für einen Streamingdienst, der nur limitierte Kinostarts erlaubt, je rentieren konnte, ist bei diesem über 150 Millionen teuren Spätwerk Martin Scorseses fraglich, doch der Film existiert und dafür kann man nur dankbar sein. Scorsese tauchte nach seinen 90er-Klassikern Goodfellas und Casino hier erneut in die Welt der Mafia ein und arbeitete damit zum ersten Mal in 20 Jahren wieder mit Robert De Niro und Joe Pesci zusammen, die beide in den Filmen mitgewirkt hatten. Anders als die feurig inszenierten 90er-Filme, die den verführerischen Anreiz sowie auch die Brutalität dieser Welt beleuchteten, blickt Scorsese in The Irishman aus seinem hohen Alter auf die Welt zurück. In seinem langsamen und unaufgeregt erzählten Epos zeigt Scorsese die Leere, die sich im Alter bei den Charakteren breitmacht. Der Anreiz ist längst verschwunden und Freunde und Familie, die einem kurz vor dem Sterben Beistand leisten könnten, hat man durch seine Taten längst verstoßen.
Der Film behandelt das Leben von Frank Sheeran und seine Beziehungen zu der Bufalino Mafiafamilie sowie Jimmy Hoffa. Indem Scorsese Gebrauch von digitaler De-Aging Technologie machte, erzählte er mit seinen gealterten Schauspielern eine Geschichte, die sich über Jahrzehnte erstreckt. Der Effekt mag auf den ersten Blick nicht vollständig gelungen und gewöhnungsbedürftig sein, und gerade in der ersten Stunde (einer immerhin beachtlichen dreieinhalb stündigen Laufzeit) kann man schon immer wieder mal erkennen, dass Robert De Niro nicht mehr die Beweglichkeit eines jungen Mannes innehat. Und doch hat man sich sehr bald daran gewöhnt und schenkt dem Effekt keinerlei Beachtung mehr. Der Effekt erfüllt seine Wirkung, denn man sieht den langsamen Prozess des Älterwerdens den Figuren zu jeder Sekunde an. Es ist ein in melancholischen Tönen schwingender Film, der, wie man es von Scorsese erwartet, gekonnt inszeniert ist und exzellente Schauspielleistungen von De Niro, Pesci und Al Pacino aufweist. Anders als noch in Goodfellas und Casino sehen sich hier die Figuren gegen Ende des Filmes nicht mit der Brutalität und Gewalt der Mafia konfrontiert, sondern mit ihrer Sterblichkeit im hohen Alter. Die Sünden ihrer Vergangenheit holen sie nicht etwa mit einem schnellen Tod ein, sondern Frank Sheeran muss nun mit den Konsequenzen leben. Von allen verlassen bleibt ihm nichts anderes mehr als der religiöse Glaube, während er im Altersheim dahinsiecht.
The Irishman ist ein Werk, das so nur von einem Altmeister wie Scorsese stammen kann. Auch Scorsese weiß, dass seine Jahre nur noch begrenzt sein können, und blickt deshalb auch auf sein Werk zurück. Hinterfragte er noch das aufregende Leben in Goodfellas mit direkten brutalen Konsequenzen, macht sich in The Irishman eine Nüchternheit breit. Was mag es einem bringen, in seinem Werk erfolgreich zu sein und lange zu leben, wenn es zu nichts als Einsamkeit und Bedauern führt. Dementsprechend langsam und behutsam ist der Film auch erzählt und gerade das macht das Epos zu einem seiner bedeutendsten Filme. Scorsese wird uns hoffentlich noch viele Jahre nicht verlassen und viele weitere Filme schenken, doch mit The Irishman hat er ein Kunstwerk geschaffen, das man auch als Abschied hätte interpretieren können. Auch wenn Netflix wahrscheinlich nie wieder so viel Geld für einen Autorenfilm ausgeben wird, dieser war es mehr als nur Wert. – Marius
Ripper Street: Krimi, Action und Korruption im London der 1890er Jahre
Die britische Krimiserie Ripper Street (2012-2016), in den Staffeln 3 bis 5 von Amazon produziert, hält nicht ganz, was ihr Titel verspricht. Im viktorianischen London angesiedelt handelt sie zwar von einer Polizeieinheit in Viertel Whitechapel, der sogenannten „H Division“, wer jedoch eine Aufarbeitung der Ripper-Morde in fiktionalisierter Serienform erwartet, wird etwas enttäuscht. Die Serie setzt ein halbes Jahr nach Jack the Rippers letztem Mord ein, und handelt primär von dem in der Mordserie ermittelnden Detective Inspector Edmund Reid (so hieß der Hauptermittler tatsächlich) sowie vom (polizeilichen) Alltag im Londoner Osten. Reid – dargestellt von Matthew Macfadyen, der vielen sicherlich in seiner Rolle als Mr. Darcy in Stolz und Vorurteil (2005) bekannt ist – hat seine Niederlage im Ripper-Fall noch nicht verkraftet. Die Ermittlungen haben ihn auch in ein persönliches Unglück gestürzt, denn er hat sich so obsessiv der Jagd nach Jack the Ripper gewidmet, dass er seine Familie vernachlässigt und traumatisiert hat. Seine Tochter Mathilda ist schließlich während einem gefährlichen Polizeieinsatz verschollen. Einige Monate danach setzt die erste Staffel der Serie ein, und gleich zu Beginn kommen all diese Gefühle wieder hoch: Es geschehen erneut Morde, die die Handschrift Jack the Rippers tragen. Reid nimmt gemeinsam mit Sergeant Bennet Drake (Jerome Flynn, bekannt aus Game of Thrones) und dem amerikanischen Militärarzt Captain Homer Jackson (Adam Rothenberg) die Ermittlungen auf und wittert seine Chance, den Mörder aus Whitechapel doch noch dingfest zu machen…
Bis hierhin ergibt der Titel Ripper Street also durchaus noch Sinn, ab der zweiten Staffel spielt Jack the Ripper jedoch kaum mehr eine Rolle. Stattdessen entfaltet sich ein ziemlich verwobenes Geflecht aus verschiedensten Handlungssträngen, das bis zum Ende der fünften und letzten Staffel aber immerhin vollständig aufgearbeitet wird. Edmund Reid glaubt daran, dass seine Tochter noch am Leben ist, und hat zugleich noch eine weit zurückreichende Fehde mit dem gefürchteten Inspector Jedediah Shine (Joseph Mawle) der benachbarten „K Division“. Der Amerikaner Jackson und seine Frau Susan „Long Susan“ Hart (MyAnna Buring), die in Whitechapel ein Bordell betreibt, haben in ihrer alten Heimat einige dunkle Geheimnisse zurückgelassen, die sie nach und nach einholen. Sergeant Drake geht nacheinander zwei unglückliche Ehen ein – und gleichzeitig sind die drei Hauptfiguren natürlich mit neuen größeren Mysterien und kleineren Zwischenfällen konfrontiert, die die Polizeiarbeit in Whitechapel ausmachen.
Nachdem all diese Fässer in der ersten und zweiten Staffel aufgemacht wurden, sollte die Serie zunächst wegen zu geringen Zuschauer*innenzahlen eingestellt werden, wurde dann jedoch von Amazon UK übernommen, sodass drei weitere Staffeln produziert werden konnten. Charakteristisch für alle Staffeln von Ripper Street sind in erster Linie viel Blut und Brutalität; um explizite Gewaltdarstellungen und verstümmelte Leichen kommt man nicht umhin. Gleichzeitig zeichnet sich die Serie im Vergleich zu ähnlich blutigen Shows wie Game of Thrones durch einen Verzicht auf die übliche, übertrieben umfangreiche Darstellung von Erotik und Nacktheit aus. Nach der Wiederaufnahme der Serie durch Amazon gibt es ab Staffel 3 außerdem ein paar merkwürdige Zeitsprünge und verwirrende Plotentwicklungen, sodass man – zumindest beim ersten Zuschauen – irgendwann die Ambition aufgibt, der Handlung bis ins Detail folgen zu können. Aber alleine in ihrer Ästhetik unterhält die Serie schon genug: In Bühnenbild und Kostümen wird das viktorianische London wunderbar eingefangen (auch wenn die Serie größtenteils in Dublin gedreht wurde), und im englischen Original unterhält der geglückte Cockney-Dialekt einiger Darsteller*innen. Auch wenn manche Handlungsstränge gelungener sind als andere, mangelt es insgesamt nicht an Spannung und Action – man möchte weiter schauen. Aber: Wer ein Fan von Happy Ends ist, der oder dem ist Ripper Street wohl nicht zu empfehlen. Ein weiteres Merkmal der Serie ist nämlich die Fehlbarkeit ihrer (Haupt-)figuren. Sie verstricken sich in ihre Lügen, begehen selbst Straftaten, halten sich nicht an ihre eigenen Moralvorstellungen, lassen sich auf Korruption und Betrug ein. Das wird ihnen allen früher oder später zum Verhängnis, was zur Folge hat, dass die letzte Staffel etwas ernüchternd endet. Gleichzeitig macht es die Serie aber auch besonders: Beim Zuschauen verteilen sich die eigenen Sympathien ständig neu, man steht nie ganz hinter den Hauptfiguren, die ebenso wie die Antagonist*innen irgendwo zwischen Gut und Böse herumwabern. Gerade Edmund Reid leistet sich von Anfang an Fehltritte, die einen empören und bestürzen, und dann empfindet man in der nächsten Szene wieder starkes Mitleid mit ihm (was nicht zuletzt an dem traurigen Blick liegt, den Matthew Macfadyen schon in Stolz und Vorurteil gezeigt hat, aber in Ripper Street zu oscarreifer Perfektion bringt). Manchmal sind es dann sogar die Gegenspieler*innen, allen voran in sehr überzeugenden Darstellungen der bereits erwähnte Jedediah Shine sowie in den Staffeln 4 und 5 Assistant Commissioner Augustus Dove (Killian Scott), die einen stärker faszinieren und für deren Handeln man mehr Verständnis aufbringen kann.
Letztendlich ist Ripper Street vielleicht nicht uneingeschränkt zu empfehlen, aber ich würde die Serie trotzdem allen ans Herz legen, die sich für Krimi, Action und vertrackte Machenschaften interessieren. Auch über das viktorianische London erfährt man viel: Neben Jack the Ripper wurden einige weitere historische Figuren und Ereignisse in die Serie eingebaut, wie der Matchgirls‘ Strike im Jahr 1888, der Stromkrieg um Gleich- und Wechselspannung oder der als „Elefantenmensch“ bekannte Joseph Merrick. Gleichzeitig werden auch Themen wie Homophobie, Antisemitismus und Misogynie verhandelt, und medizinische und technische Entwicklungen des späten 19. Jahrhunderts aufgegriffen. Natürlich ist Ripper Street keinesfalls eine historische Dokumentation über Leben und Verhältnisse in Whitechapel, und viele Aspekte (allen voran das Wirken Edmund Reids) sind stark fiktionalisiert – aber dennoch fühlt man sich bei Zuschauen in ein realistisch gezeichnetes London der 1890er Jahre hineinversetzt. – Sonja