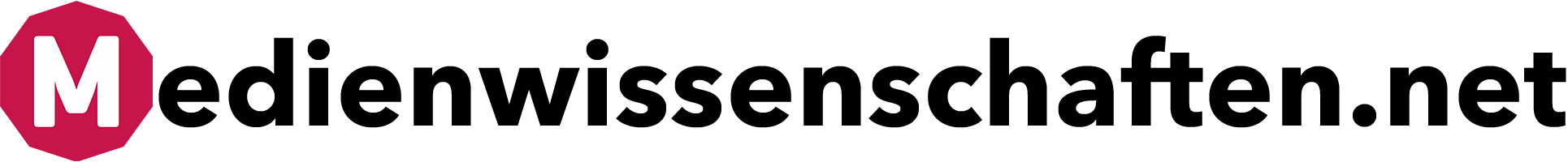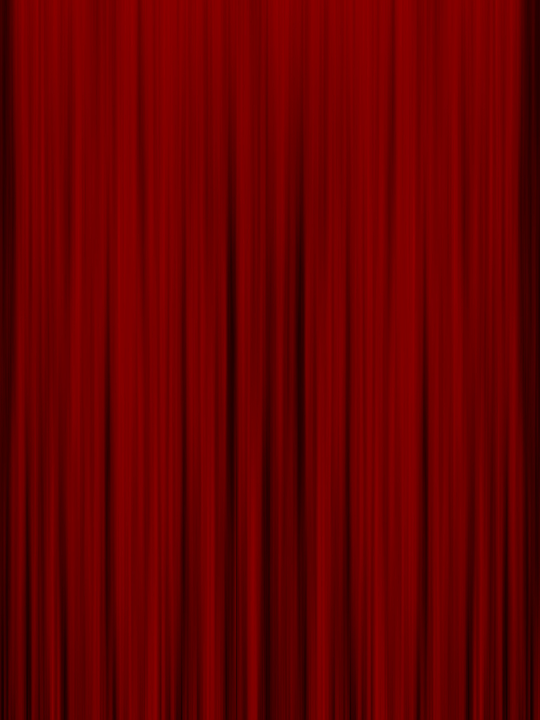Mit dem lang erwarteten Sequel zum erfolgreichsten Film aller Zeiten, beweist James Cameron einmal mehr den Skeptikern, dass in Sachen Action und visuellen Effekten kaum jemand an ihn herankommt und erzählt zudem eine Familiengeschichte, die ihm nah am Herzen liegt.
13 Jahre hat man gewartet. Nicht nur auf die Fortsetzung des erfolgreichsten Films aller Zeiten, sondern auch auf den ersten Film von James Cameron (Terminator, Titanic), seitdem er das Kino mit seinem 3D Spektakel revolutionierte. In der Zwischenzeit, wo er an gleich 4 Sequels zu seinem Film arbeitete, hat er aber nicht nur U-Boote gebaut, um an die tiefsten Stellen des Meeres zu tauchen. Auch die Kinolandschaft erlebte mehrere Umbrüche und den Aufstieg des wohl größten Franchise Booms aller Zeiten mit dem Marvel Cinematic Universe an erster Stelle. Und so eröffnete sich auch der Diskurs über Avatar selbst. Wie relevant ist ein Sequel zu diesem Film noch? Tatsächlich vielleicht sogar relevanter als noch in 2009. Camerons beispielloses Geschick im Action-Kino wurde in den letzten Jahren mehr und mehr vermisst. Er machte keinen Hehl aus seiner Skepsis gegenüber den Superheldenfilmen, doch gerade jetzt wirkt The Way of Water, als würde ein gealterter Experte des Blockbusterkinos kopfschüttelnd auf die Kinolandschaft blicken und zurückkommen, um zu zeigen, wie man es denn nun richtig macht. Die eigentliche Frage ist schließlich, ob es James Cameron gelingt, das Publikum für seine Vision zurückzugewinnen und es 13 Jahre später aufs Neue zu begeistern.
Natürlich sind einem viele Klischees, die Cameron in seinen Avatar Filmen (und durchaus ja auch in allen seiner Filme) benutzt, bekannt. Doch sind die Blockbuster der letzten Jahre wohl selten für radikale neue Geschichten bekannt. Die Kritik Avatar sei ja nur Der mit dem Wolf Tanzt und FernGully in Blau schien schon immer etwas verfehlt, wenn gleichzeitig der 13. Spider-Man Film abgefeiert wurde, aber Cameron arbeitet nicht ohne Grund mit bekannten Klischees und traditionellem Storytelling. Seine Methoden bewähren sich wieder und wieder und ziehen Kinogänger in ihren Bann. Ihm ging es schon immer darum, die altbekannten Muster, die sich nicht ohne Grund in der Vergangenheit bewährt haben, in eine fesselnde Geschichte zu packen. Erst damit lassen sich seine massiven Kinoerfolge erklären und The Way of Water steht diesen Qualitäten in nichts nach. Der Film folgt einer ähnlichen Struktur wie der erste Teil. Erneut führt Cameron die Zuschauer*innen zuerst in die Welt ein und stellt alle für den späteren Film entscheidende Elemente in einer selten subtilen Weise, aber mit Effizienz vor. Dabei mag er noch so oft mit simplen Dialogen arbeiten, sie dienen jedoch stets einem Zweck. Alle wichtigen Charaktere erhalten Vorstellungen, die in einer Szene das Wichtigste über sie verraten. Kein Element ist dabei ohne Grund im Film, am Ende dient es stets dem Ausbau der Familiendynamik, die Cameron so nah am Herzen liegt. Sind die Figuren einmal eingeführt, so lässt Cameron sie in die neue Welt der Na’vi Wasserstämme eintauchen. Diese neue Kultur lernen die Figuren und die Zuschauer*innen nun gemeinsam kennen, ähnlich wie damals im ersten Film als Jake lernen musste, sich in die Na’vi zu integrieren. Wenn am Ende das große Finale wartet, hat man sowohl die Familie, wie auch das neu gewonnene Zuhause mehr als gut kennen gelernt.
Cameron schafft eine komplexe Familiendynamik, getrieben insbesondere durch die zentrale Vater-Sohn-Beziehung, in der Jake Sullys teils militärische Erziehungsmethoden und der ungehorsame Charakter seines zweiten Sohnes Lo’ak in den Konflikt kommen. Lo’aks unerlaubte Freundschaft zu einem Walähnlichen Wesen bildet auch das Herzstück des zweiten Aktes. Spider ist als wichtigste menschliche Figur ein Charakter, der gezwungenermaßen zwischen den Fronten steht. Der Wunsch, zu Sully’s Familie dazu zugehören, wird durch die Rückkehr Stephen Lang’s als Quaritsch (nun selbst in einem Avatar Körper) verkompliziert. Lang hat sichtlich Spaß daran, mit dem Franchise noch nicht fertig zu sein und gibt einer der komplexesten Figurendynamiken im Film seine Nuancen. Jake und Neytiris Adoptivtochter Kiri, geboren von Grace Augustines Avatar Körper aus dem ersten Film, ist wohl das zweite Herzstück des Films. Gespielt von einer 70-jährigen Sigourney Weaver, ist ihr Charakter wohl der Beweis der Vielfalt, welche die Motion-Capture Technologie zulässt. Es gehört wohl zu den größten Wundern des Filmes, dass dieses Konzept aufgeht und Weaver’s Schauspielleistung überzeugt auf ganzer Linie. Dass in einem der massentauglichsten Filme des Jahres ausgerechnet eine 70-Jährige Schauspielerin eine Teenagerin spielen, zeugt wohl von der immensen Freiheit, die James Cameron genießt.
Diese Freiheit zahlt Cameron den Zuschauer*innen mit einem unvergleichbaren visuellen Spektakel zurück. Seine Affinität für das Wasser sollte einem spätestens nach The Abyss und Titanic bekannt sein, doch noch nie hatte er die Möglichkeit, in vergleichbare Unterwasserwelten einzutauchen. Was der zweite Akt des Filmes an wunderschöner Natur und Kreaturen bietet erstaunt und baut eine Welt, von der man sich nicht ohne Grund wünschen würde, sie wäre real. James Cameron meldet sich auch mit der 3D Technologie zurück, um die immersive Erfahrung eines solchen Kinoerlebnis einmal mehr unter Beweis zu stellen. Gerade in den Unterwasseraufnahmen bietet sie eine Tiefe in den Bildern, die ihresgleichen suchen.
Die Ökologischen Botschaften des Filmes treten nur umso stärker in den Vordergrund. Für die vergleichbaren Umstände der fiktiven indigenen Bevölkerung des Planeten zu den realen Verhältnissen auf der Erde, hat Cameron schon viel Lob erhalten, wie auch viel Kritik einstecken müssen. Doch zweifellos ist die kapitalistische Industrie hier böser denn je, zerstört sie doch all die tiefen Verbindungen zur Natur, welche die Na‘vi pflegen und die der Mensch schon lange aufgegeben hat. Mit dem Finale stellt Cameron auch erneut ein Verständnis von der Geographie des Schauplatzes und von Kameraführung unter Beweis, welche ihn schon immer an die Spitze von Regisseuren seiner Art gestellt hat. Man mag kaum glauben, dass das Wasser wohl zu keinem Zeitpunkt des Filmes echt ist (die Arbeit mit Motion-Capture Unterwasser hat sich allerdings sichtlich bewährt), doch es ist auch die realitätsnahe Kameraführung, welche den Eindruck von etwas Greifbaren erzeugt. Selbst mit all den Freiheiten, die er auf technischer Ebene genießt, lässt Cameron die Kamera stets so agieren, als würde sie etwas Reales im Bild aufnehmen. Sie zoomt, versucht mit den Figuren Schritt zu halten und führt nie offensichtlich computeranimierte Bewegungen aus. Das Finale ist mitreißend und spannend, denn so sehr Cameron das Wasser auch liebt, versteht er gleichzeitig wie furchteinflößend es sein kann. Das kann man von dem Regisseur von Titanic wohl auch erwarten.
So atemberaubend das Finale auch ist, funktioniert es aber auch nur, da nun all die so gezielt eingeführten Elemente des Filmes hier ihre zufriedenstellende Auflösung erhalten. Wie die besten Action Regisseure verstand Cameron schon immer, dass Action-Sequenzen auch Geschichten erzählen, eine Eigenschaft, die ihn zu einem viel stärkeren Geschichtenerzähler macht, als es seine Kritiker gerne behaupten. Avatar: The Way of Water ist ein Film, der zum Mitfiebern und zum Mitjubeln verleitet. Aber auch ein Film, der die Geschichte über eine Familie erzählt, über die Assimilation in eine neue Kultur, über Freundschaften und eben ein Film, der alle Generationen anspricht. Am Ende ist wohl für jedes Herz etwas dabei. Selbst wenn man mal über die eine oder andere Stelle stolpert, wird man an einer anderen wiederum abgeholt. Es ist ein Blockbuster, der mit seiner visuellen Wucht wohl die meisten großen Filme der letzten Jahre schlecht aussehen lässt und verdientermaßen Menschen erneut in die Kinos lockt. Es mag verwundern, dass es James Cameron gelingt, eine solche breite Masse an Zuschauer*innen mit seinem Film ansprechen zu können. Allerdings hat er ja schließlich auch jeweils mit Titanic und Avatar Kinokassenrekorde gebrochen. Eigentlich hätte man es wohl kommen sehen müssen. Doch das war mit seinen vorherigen Kinoerfolgen ja auch nie der Fall.
Anmerkung der Redaktion: Nicht alle verlassen die Kinovorstellung derart euphorisch wie Marius. Wenn euch interessiert wie weit die Meinungen zu Avatar auseinander gehen können, lest Ivanas Rezension, in der sie sich nicht vor Kritik scheut.